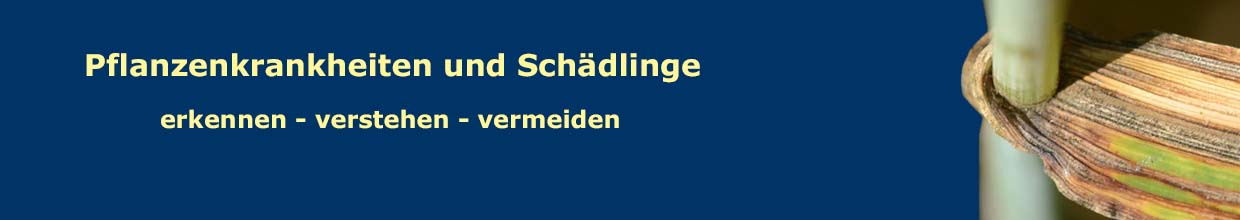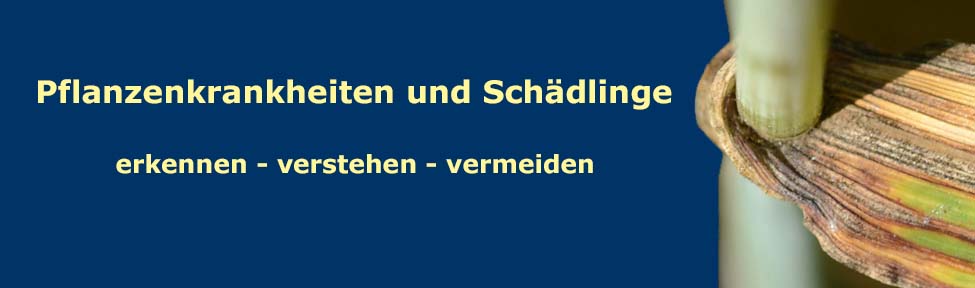Kraut- und Knollenfäule
Mildiou de la pomme de terre (franz.); late blight (engl.)
wissenschaftlicher Name: Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
Taxonomie: Chromista, Peronosporomycetes (früher Oomycota oder Oomycetes), Peronosporea, Peronosporidae, Peronosporales, Peronosporaceae
Die Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) ist weltweit die mit Abstand wichtigste und bekannteste Krankheit der Kartoffel. Dieser Erreger war Ende der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts in Irland für eine grosse Hungersnot und damit für den Tod von mehr als einer Million Iren verantwortlich. Als Folge des Zusammenbruchs des Kartoffelanbaus wanderten unzählige Iren nach Amerika aus. Auch andere Teile Europas waren von dieser neu auftretenden Kartoffelkrankheit stark betroffen. Feucht-warme Witterung begünstigt die Krankheit und kann zu Ertragsverlusten von 20 bis 40 % bis hin zu einem Totalausfall führen (Radtke und Rieckmann 1990). Der Krankheitserreger befällt alle Teile der Kartoffelpflanze. Er zerstört die Blätter, befällt die Knollen und verursacht Lagerverluste. P. infestans steht daher im Mittelpunkt aller Fungizidmassnahmen im Kartoffelanbau.

 Abb. 1. Krautfäule (Phytophthora infestans) an Kartoffeln: Links anfällige, rechts resistente Sorte (Bild oben), auf der Blattunterseite bildet sich vor allem morgens am Übergang vom abgestorbenen Gewebe zum noch gesunden Blatt ein weisser Pilzrasen (bestehend aus Sporangienträgern und Sporangien) (Bild unten).
Abb. 1. Krautfäule (Phytophthora infestans) an Kartoffeln: Links anfällige, rechts resistente Sorte (Bild oben), auf der Blattunterseite bildet sich vor allem morgens am Übergang vom abgestorbenen Gewebe zum noch gesunden Blatt ein weisser Pilzrasen (bestehend aus Sporangienträgern und Sporangien) (Bild unten).
Schadbild
Die Kraut- und Knollenfäule, auch Braunfäule genannt, kann alle Teile der Kartoffelpflanze befallen (Abb. 1 und 2). Das Aussehen der einzelnen Blattflecken variiert je nach Alter des Blattes und den Umweltbedingungen. Die ersten Symptome der Krankheit zeigen sich als kleine, graubraune, wasserdurchtränkte Blattflecken mit hellgrünem Rand. Die Flecken werden schnell grösser und kreisförmig. Sie werden nicht von den Blattadern begrenzt. Typische Blattflecken haben in der Mitte abgestorbenes braunes Gewebe und einen hellgrünen oder chlorotischen Randbereich. Bei feuchter Witterung (früh am Morgen und spät am Abend) bildet sich an der Blattunterseite am Übergang vom abgestorbenen zum noch gesunden Blatt ein weisser Pilzrasen. Dieser besteht aus Sporangienträgern und Sporangien. Bie trockener Witterung werden die Flecken spröde und brüchig.
Befallene Kartoffelstängel zeigen dunkelgrüne bis schwarze Flecken, vorwiegend an der Spitze oder an den Verzweigungen der Blattstiele. Bei sehr feuchter Witterung und mittleren Lufttemperaturen kann sich auch an den Stängeln ein weisser Pilzrasen bilden. Die Stängelstruktur wird vom Erreger nicht zerstört, so dass nach einem vollständigen Zusammenbruch des Bestandes nur noch dürre Stängel sichtbar sind. Stark befallene Felder verbreiten einen muffigen Geruch.
Befallene Kartoffelknollen haben äusserlich eingesunkene, graubraune Flecken. Im Innern der Knolle zeigen sich diffuse braune Flecken, die nicht scharf vom gesunden Gewebe abgegrenzt sind. Sie öffnet zahlreichen anderen Parasiten den Weg in die Knolle.
Krankheitserreger
Die vegetativen Zellen von P. infestans sind diploid (obwohl in einigen Fällen ein höherer Ploidiegrad beobachtet wurde). P. infestans ist heterothallisch mit zwei bekannten Paarungstypen A1 und A2. Seit den siebziger Jahren kommen in Europa beide Typen vor. Wenn sie miteinander in Kontakt kommen, kommt es zur Bildung von diploiden Dauersporen (geschlechtliche Fortpflanzung), den sogenannten Oosporen (Durchmesser 24-46 µm) (Stevenson et al. 2001). Oosporen sind dickwandig und können längere Zeit auf abgestorbenem Pflanzenmaterial oder im Boden überleben.
Die ungeschlechtliche Vermehrung erfolgt durch die Bildung von Sporangien (Abb. 3 und 4). Diese sind zitronenförmig, 21-23 x 21-38 µm gross und besitzen mehrere Zellkerne (Stevenson et al. 2001). Sie werden an verzweigten Sporangienträgern gebildet, die aus den Spaltöffnungen wachsen.
Die Sporangien keimen direkt oder entlassen jeweils 3 bis 8 Zoosporen (bei Temperaturen unter 18 °C). Die Zoosporen haben einen Zellkern und sind seitlich begeisselt.
 Abb. 3. Sporangienträger mit Sporangien von Phytophthora infestans wachsen aus den Spaltöffnungen.
Abb. 3. Sporangienträger mit Sporangien von Phytophthora infestans wachsen aus den Spaltöffnungen.
 Abb. 4. Sporangien von Phytophthora infestans
Abb. 4. Sporangien von Phytophthora infestans
Lebenszyklus
Die Krautfäule überwintert hauptsächlich in befallenen Kartoffelknollen im Lager oder auf dem Feld. Bedingungen, welche das Überleben der Knolle ermöglichen, genügen auch dem Erreger, um am Leben zu bleiben. Erstinfektionen (Primärherde) gehen von befallenen Stängeln von infiziertem Pflanzgut oder von eingeflogene Sporangien aus. Letztere stammen von benachbarten Feldern (zum Beispiel Frühkartoffeln), von infizierten Knollen in Abfallhaufen und Kartoffelmieten oder von Durchwuchskartoffeln. In seltenen Fällen erfolgt die Primärinfektion durch bodenbürtige Dauersporen (Oosporen).
Gelangen die Sporangien auf ein tau- oder regennasses Kartoffelblatt, so keimen sie bei Temperaturen von 8-18 °C indirekt mit Zoosporen (Stevenson et al. 2001). Bei höheren Temperaturen von 18-24 °C erfolgt eine direkte Keimung der Sporangien mit einer Keimhyphe. Die Zoosporen können sich für eine kurze Zeit aktiv in den Wassertropfen bewegen. Später werfen sie die Geisseln ab, entwickeln sich zu einer Zyste, keimen und bilden Haftorgane (Appressorien) (Kamoun and Smart 2005, Nowicki et al. 2012). Von dort dringt eine Penetrationshyphe durch die Kutikula in eine Epidermiszelle ein, wo der Parasit ein Infektionsvesikel bildet. Anschliessend wachsen zwischen den Pflanzenzellen verzweigte Hyphen, die fingerförmige Haustorien in den benachbarten Zellen bilden. Während dieser kurzen Phase im Lebenszyklus von P. infestans ernährt sich der Parasit von lebenden Zellen (biotroph). Später stirbt das infizierte Pflanzengewebe ab und der Parasit versorgt sich mit Nährstoffen aus den abgestorbenen Pflanzenzellen (nekrotroph). Der Lebenszyklus von P. infestans ist typisch für einen hemibiotrophen Erreger.
Das Myzel produziert Sporangienträger, die aus den Spaltöffnungen austreten und Sporangien (ungeschlechtliche Sporen) bilden. Die Sporangien werden durch Regenspritzer oder Wind verbreitet. Sie entlassen bei kühler, feuchter Witterung Zoosporen oder können direkt keimen (siehe oben).
P. infestans befällt auch Kartoffelknollen. Mt Regen- und Bewässerungswasser können Sporangien von infizierten Pflanzen zu den sich entwickelnden Knollen gespült werden, so dass auch diese befallen werden. Je tiefer die Knolle im Boden liegt, desto geringer ist die Infektionsgefahr. Hohe Dämme reduzieren den Befall der Knollen deutlich. Knolleninfektionen können auch während der Ernte oder im Lager (eher selten) auftreten.
Seit der Einschleppung des Paarungstyps A2 kann sich P. infestans in Europa auch geschlechtlich vermehren. Kommen die Paarungstypen A1 und A2 miteinander in Kontakt, kommt es zur Bildung von ausdauernden Oosporen. Diese Möglichkeit der geschlechtlichen Fortpflanzung führt zu einer grösseren genetischen Variabilität innerhalb der P. infestans Population und der Parasit kann sich schneller und besser an die Umwelt anpassen: Er kann Resistenzen der Kartoffel durchbrechen oder kann Resistenzen gegen Fungizide entwickeln.
Epidemiologie
Phytophthora infestans ist ein obligater Parasit, der zum Überleben zwischen zwei Anbauperioden auf infizierte Knollen angewiesen ist. Knolleninfektionen sind deshalb für das Auftreten der Krankheit besonders wichtig. Eine Ausnahme bildet der sexuelle Zyklus, bei dem Oosporen gebildet werden, die im Boden ohne Wirtspflanzen monate- bis jahrelang überleben können (Stevenson et al. 2001).
In den gemässigten Zonen Europas erscheinen die ersten Symptome der Krautfäule anfangs Juni. In Frühkartoffelfeldern (zum Beispiel unter Folien) kann dieser Krankheitserreger auch schon im Mai auftreten. Die Krankheit wird durch feucht-warme Witterung begünstigt. Im Extremfall kann die gesamte Ernte vernichtet werden.
Eine feuchte und kühle Witterung ermöglicht es dem Krautfäuleerreger, in kurzer Zeit eine enorme Menge an Sporangien zu produzieren. Gelangen diese Sporangien auf anfälliges Pflanzenmaterial keimen sie bei Temperaturen von 18-24 °C direkt mit einem Keimschlauch, bei Temperaturen von 8-18 °C bilden sie Zoosporen. Die Infektion von anfälligem Pflanzengewebe geschieht oft schon innerhalb von 2 Stunden. Unter optimalen Bedingungen (18-22 °C) sind die ersten Krankheitssymptome bereits nach drei Tagen sichtbar. Ein bis zwei Tage später (bei 10-25 °C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit) bildet der Erreger neue Sporen (Stevenson et al. 2001).
Gelangen die Sporangien mit dem Regenwasser von den Blättern oder Stängeln in den Boden, können sie die Knollen infizieren. Das Anhäufeln der Kartoffelpflanzen kann einer Knolleninfektion vorbeugen.
Krautfäuleresistenz
Für einen erfolgreichen Kartoffelanbau ist die Sortenwahl wichtig. Besonders gefragt sind Sorten mit verbesserter Resistenz gegen die Kraut- und Knollenfäule.
P. infestans kann eine Resistenz, die nur auf einem Gen beruht, innerhalb weniger Jahre durchbrechen. Deshalb ist es notwendig mehrere funktionierende Resistenzgene gleichzeitig in einem Genotyp zu vereinigen (Pyramidisierung), um so die Chancen einer Resistenzbrechung zu minimieren und die Stabilität der Resistenz zu erhöhen.
Wirtsspektrum
Phytophthora infestans befällt Kartoffeln, Tomaten, Peperoni und viele andere Nachtschattengewächse (Solanaceae). Es existieren zahlreiche Pathotypen des Erregers.
Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung
- Infizierte Knollen sind sehr wichtig für das Überleben des Pilzes von einer Saison zur nächsten. Befallene Knollen sollten daher möglichst aus dem Produktionssystem "Kartoffel" entfernt werden: Kartoffelabfälle fachgerecht entsorgen (zum Beispiel durch tiefes Vergraben), keine kranken Knollen pflanzen und Durchwuchskartoffeln (auch in anderen Kulturen) entfernen.
- Wenig anfällige, widerstandsfähige Sorten anbauen. Die Anfälligkeit der Kartoffelsorten für die Kraut- und Knollenfäule ist in der Schweizer Sortenliste für Kartoffeln, in der Sortenliste des Bundessortenamtes für Deutschland und in der Österreichischen beschreibenden Sortenliste angegeben. Kraut und die Knollen einer Sorte sind oft nicht gleichermassen anfällig oder resisten. Im Allgemeinen sind frühe Sorten anfälliger als später reifende Sorten.
- Durch Vorkeimen der Pflanzkartoffeln können befallene Knollen erkannt und aussortiert werden. Die Ertragsbildung beginnt früher und das Ausfallrisiko wird verringert.
- Das Anhäufeln der Kartoffelpflanzen wirkt der Knollenfäule entgegen. Die an der Oberfläche liegenden Knollen werden immer zuerst befallen. Je höher die darüber liegende Erdschicht ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sporangien darin zurückgehalten werden.
- Für eine gute Durchlüftung der Bestände sorgen, damit die Pflanzen schnell abtrocknen. Dazu gehören auch die Unkrautbekämpfung und eine angepasste Düngung,
- Befallenes Kraut rechtzeitig vernichten (mechanisch, thermisch oder chemisch)
- Knollen nur bei trockenem Wetter und gut abgetrocknetem Boden ernten, um den Erdbesatz an den Knollen zu reduzieren. Die Ernte der Knollen sollte erst 3-4 Wochen nach der Krautvernichtung bzw. nach dem Absterben des Krautes erfolgen, wenn die Knollen schalenfest sind. Die Knollen bei guter Durchlüftung zwischenlagern und nach 3-4 Wochen sortieren (Häni et al. 2008). Mit Knollenfäule befallene Knollen dürfen nicht ins Lager gelangen, da diese häufig sehr schnell von Nass- und Trockenfäuleerregern sekundär befallen werden. Diese vernichten innerhalb weniger Wochen das gesamte Lager.
- Im biologischen Landbau dürfen nur Kupferpräparate aus der Liste der chemischen Pflanzenschutzmitteln verwendet werden (Betriebsmittelliste des FiBL). Die maximal erlaubte Menge an Kupfer beträgt pro Hektare und Jahr 4 kg (Bio Suisse), Demeter-Betriebe dürfen kein Kupfer einsetzen. Warn- und Prognosesystemen, wie zum Beispiel PhytoPRE, ermöglichen einen gezielten Einsatz dieser Mittel.
- Kupfer reichert sich im Boden an und stellt ein erhebliches Risiko für Bodenorganismen dar. Deshalb wird intensiv nach Alternativen gesucht. Das Pflanzenstärkungsmittel Kaliumphosphonat, Pflanzenextrakte (z.B. gemahlene Faulbaumrinde) oder aus Pilzen (Schnecklinge) isolierte Substanzen zeigten eine gute Wirkung gegen die Krautfäule (Eschen-Lippold et al. 2009, Krebs et al. 2013).
- Direkte Bekämpfung: Die Auswahl an Fungiziden ist gross (siehe unten). Die Wahl und die Häufigkeit der Anwendung hängen von der Anfälligkeit der Sorte, der Witterung und dem Verlauf der Epidemie ab. Der rechtzeitige Beginn der Spritzuingen ist entscheidend für eine erfolgreiche Bekämpfung der Krautfäule. Die erste Behandlung muss vor dem ersten Auftreten eines Befalls erfolgen, um ein massenhaftes Auftreten von Sporen im Bestand zu verhindern. Auch hier ermöglichen Warn- und Prognosesysteme (z.B. PhytoPRE) einen gezielten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (Fungizide oder alternative Mittel). Populationen von P. infestans (vor allem bei Vorliegen des Paarungstyps A2) können Resistenzen gegen die Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln entwickeln.
- Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen die Kraut- und Knollenfäule finden Sie für die Schweiz im BLW Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit).
Literatur
Eschen-Lippold L, Draeger T, Teichert A, Wessjohann L, Westermann B, Rosahl S, Arnold N, 2009. Antioomycete Activity of γ-Oxocrotonate Fatty Acids against P. infestans. J. Agric. Food Chem., 57 (20): 9607–9612.
Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A und Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.
Kamoun S, Smart CD, 2005. Late blight of potato and tomato in the genomics era. Plant disease 89: 692-699.
Krebs H, Musa T, Vogelgsang S, Forrer HR, 2013. Kupferfreie Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule im Bio-Kartoffelbau. Agrarforschung Schweiz 5 (5): 238-243.
Nowicki M, Foolad MR, Nowakowska M, Kozik EU, 2012. Potato and Tomato Late Blight caused by Phytophthora infestans: An overview of Pathology and Resistance Breeding. Plant Disease Vol. 96: 4-17.
Radtke W, Rieckmann W, 1990. Krankheiten und Schädlinge der Kartoffel. Verlag Th. Mann, Gelsenkirchen-Buer, 167 S.
Stevenson WR, Loria R, Franc GD, Weingartner DP, 2001. Compendium of Potato Diseases, second edition. The American Phytopathological Society, St. Paul: 106 S.