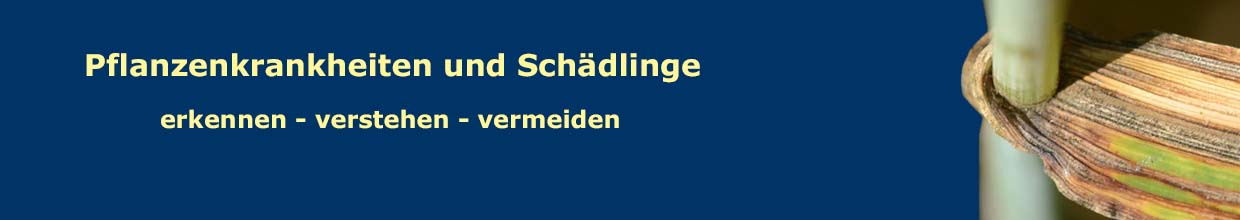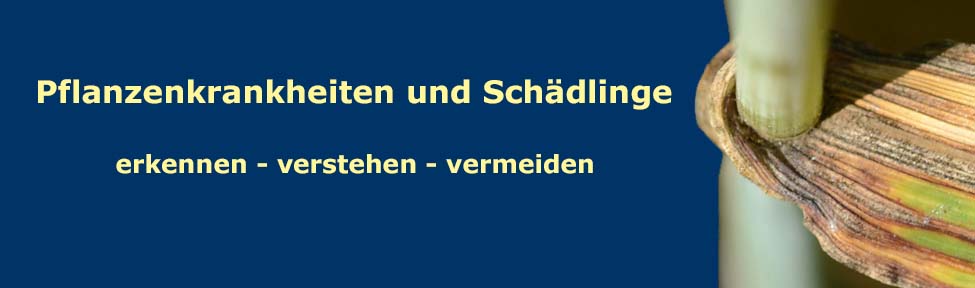Kartoffelschorf
gale commune (franz.); common scab (engl.)
wissenschaftlicher Name: Streptomyces scabies (Taxt.) Waksman et Henrici, und andere Streptomyces-Arten
Synonym: Streptomyces scabiei
Taxonomie: Bacteria, Actinobacteria, Actinomycetales, Streptomycineae, Streptomycetaceae
Kartoffelschorf ist eine durch Bakterien (Streptomyces spp.) verursachte Krankheit der Kartoffelknolle und kommt in allen Kartoffelanbaugebieten vor. Auf leichten Böden und nach Trockenheit während des Knollenansatzes kann es zu grösseren Schäden kommen. Starker Schorfbefall mindert den Marktwert von Speisekartoffeln erheblich und führt zu erhöhten Schäl- und Gewichtsverlusten. Der Geschmack wird jedoch nicht beeinträchtigt. Die Auswirkung eines Befalls auf den Ertrag ist gering. Die Wahl widerstandsfähiger Sorten, eine gesunde Fruchtfolge und eine gleichmässige Bodenfeuchte zu Beginn der Knollenbildung vermindern den Befall mit Kartoffelschorf.
 Abb. 1. Verschiedene Ausprägungen des Kartoffelschorfs (Streptomyces spp.)
Abb. 1. Verschiedene Ausprägungen des Kartoffelschorfs (Streptomyces spp.)
Krankheitsbild
Kartoffelschorf tritt in der Regel nur an den Knollen auf, in Ausnahmefällen auch an den Stolonen. Unter Schorf versteht man unregelmässig verteilte, braune, rissige und verkorkte Flecken auf der Knollenoberfläche. Man unterscheidet folgende Ausprägungen der Krankheit:
Ein flächiger Befall mit netzartigen Rissen wird als Netzschorf bezeichnet (Abb. 2). Diese Symptome kommen bei einigen Sorten vermehrt vor.
Abb. 2. Netzschorf: flächiger Befall mit netzartigen RissenBeim Flachschorf ist nur das äussere Gewebe abgestorben (Abb. 3). Auf der Kartoffelschale sind flache, pustelartige Befallsstellen mit rauer und borkiger Oberfläche sichtbar. Sie sind unregelmässig über die Knollenoberfläche verteilt.
Abb. 3. Flachschorf: Auf der Schale sind flache, pustelartige Befallsstellen mit rauer und borkiger Oberfläche sichtbar.Dringt der Schorf tiefer ins Gewebe ein, spricht man von Tiefschorf (Abb. 4). Es entstehen wenige Millimeter tiefe, furchige Narben mit aufgeworfenen Rändern.
Abb. 4. Tiefschorf: Das Knollengewebe ist kraterförmig in die Knolle eingesunken.Der Buckelschorf entsteht durch die Bildung von neuem Gewebe unter den geschädigten Stellen, wodurch die pustelartige Befallsstelle angehoben wird (Abb. 5).
Abb. 5. Buckelschorf: Die pustelartige Befallsstelle ist angehoben.Die verschiedenen Schorfformen werden nicht durch verschiedenen Krankheitserregern verursacht, sondern entstehen in Abhängigkeit von der Aggressivität des Erregers, den Resistenzeigenschaften der Wirtspflanze, dem Zeitpunkt der Infektion, der Geschwindigkeit der Wundkorkbildung und den Umweltbedingungen. Zwischen den einzelnen Formen sind alle Übergänge möglich.
Verwechslungsmöglichkeiten: Tiefschorf kann leicht mit Pulverschorf (Spongospora subterranea) verwechselt werden. Beim Pulverschorf sind die Pusteln mit braunem Sporenpulver (Sporenballen) gefüllt.
Krankheitserreger
Kartoffelschorf wird durch verschiedenen Arten der Gattung Streptomyces verursacht. Streptomyces ist eine sehr artenreiche Gattung der Aktinobakterien. Die Arten dieser Gattung sind grampositiv, aerob, bilden ein fadenförmiges Myzel, sind mehrzellig, bilden Sporen und haben einen hohen GC-Gehalt (Guanin und Cytosin) in der DNA (www.wikipedia.org). Sie kommen hauptsächlich in Böden vor. Der Name „Strahlenpilz“ist eine veraltete Bezeichnung für Aktinobakterien.
Streptomyces Arten, die Kartoffelschorf verursachen, produzieren das Pflanzengift Thaxtomin, das an der Entwicklung der Krankheitssymptome beteiligt ist.
Lebenszyklus und Epidemiologie
Der Erreger des Kartoffelschorfs ist ein Bakterium, das in den meisten Böden vorkommt. Das Bakterium kann auch mit Pflanzgut übertragen werden, was jedoch von untergeordneter Bedeutung ist, da es in allen Anbaugebieten weit verbreitet ist. Der Erreger des Kartoffelschorfs benötigt Sauerstoff zum Überleben und ist deshalb auf leichten, sandigen Böden häufiger anzutreffen als auf schweren, schlecht durchlüfteten Böden. Er bevorzugt zudem basische Böden. In einem biologisch aktiven Boden steht der Erreger in starker Konkurrenz zu anderen Mikroorganismen.
Die Bakterien infizieren die jungen Knollen über Wunden, Atemöffnungen (Lentizellen) oder durch die unverletzte Schale. Hohe Temperaturen und Trockenheit während des Knollenansatzes begünstigen den Befall. Junges, wachsendes Gewebe (bis zu einer Knollengrösse von 2 cm) ist besonders anfällig (Radtke und Rieckmann 1990). Nach Abschluss der Knollenbildung breitet sich die Krankheit nicht mehr weiter aus.
Wirtsspektrum
Streptomyces scabies befällt neben Kartoffeln (Solanum tuberosum) unter anderem auch Zucker- und Futterrüben (Beta vulgaris), Rettich (Raphanus sativus), Speiserüben (Brassica rapa), Karotten (Daucus carota) und Pastinaken (Pastinaca sativa) (Radtke und Rieckmann 1990).
Vorbeugende Bekämpfungsmassnahmen
- Auf Böden, die das Auftreten des Kartoffelschorfs begünstigen, sollten widerstandfähige Sorten angebaut werden. Die Schorfanfälligkeit der Sorten ist in der Schweizer Sortenliste für Kartoffeln, in der Sortenliste des Bundessortenamtes für Deutschland und in der Österreichischen beschreibenden Sortenliste angegeben.
- Eine geregelte Fruchtfolge auf gefährdeten Böden mindert das Befallsrisiko. Vorsicht nach Zuckerrüben und mehrjährigem Kunstwiesenanbau (Häni et al. 2008).
- Eine Gründüngung oder Stallmist fördert im Boden lebende Gegenspieler (Bacillus subtilis) und vermindert den Befall mit Kartoffelschorf (Kühne et al. 2006).
- Physiologisch saure Dünger verwenden und im Jahr vor dem Kartoffelanbau auf Kalkung verzichten.
- Künstliche Bewässerung bei Trockenheit während des Knollenansatzes: Sauerstoff wird durch das Beregnungswasser aus dem Dammbereich verdrängt.
Literatur
Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A und Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.
Kühne S, Burth U, Marx P, 2006. Biologischer Pflanzenschutz im Freiland. Eugen Ulmer KG, Stuttgart: 288 S.
Radtke W, Rieckmann W, 1990. Krankheiten und Schädlinge der Kartoffel. Verlag Th. Mann, Gelsenkirchen-Buer, 167 S.
Stevenson WR, Loria R, Franc GD, WeingartnerDP, 2001. Compendium of Potato Diseases, second edition. The American Phytopathological Society, St. Paul: 106 S.