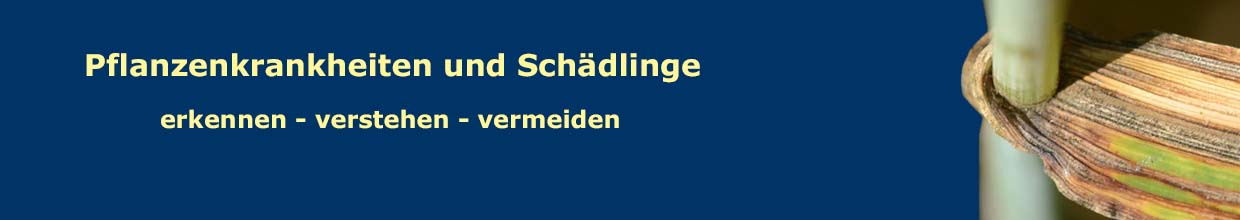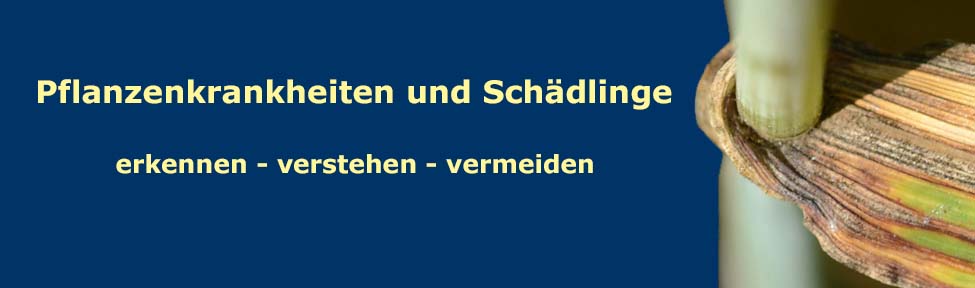Pulverschorf
gale poudreuse (franz.); powdery scab (engl.)
wissenschaftlicher Name: Spongospora subterranea f.sp. subterranea (Wallr.) Lagerh.
Taxonomie: Chromista, Rhizaria, Retaria, Endomyxa, Phytomyxea, Plasmodiophorida, Plasmodiophoridae
Spongospora subterranea ist der Erreger von Pulverschorf an Kartoffeln. Die Krankheit kommt vor allem unter kühlen und feuchten Umweltbedingungen vor. Das auffälligste Symptom sind Pusteln, die mit einer trockenen, pulverförmigen Masse von Dauersporen gefüllt sind. Bei der Ernte platzen die Pusteln auf und geben die Sporen frei. Zurück bleiben kraterförmige Hohlräume, die von Schalenresten begrenzt werden. Die Dauersporen bleiben im Boden bis zu 6 Jahre lebensfähig. Die Einhaltung einer weiten Fruchtfolge und die Verwendung von gesundem, zertifiziertem Pflanzgut sind daher wichtige vorbeugende Massnahmen. S. subterranea ist ein Überträger des Mop-Top Virus.
Bedeutung
Mit Pulverschorf befallene Kartoffeln werden als Pflanzgut zurückgewiesen und können wegen ihres schorfigen Aussehens auch nicht vermarktet werden. Ausserdem trocknen befallene Kartoffeln während der Lagerung aus und schrumpfen. Sie bieten vielen Fäulnispilzen günstige Infektionsbedingungen.
Spongospora subterranea ist ein Überträger der Mop-top Viruskrankheit. Das Virus verursacht braune Ringe mit einem Durchmesser von ein bis fünf Zentimetern auf der Knollenoberfläche und im Knolleninnern (Merz et al. 2009).
 Abb. 1. Pulverschorf (Spongospora subterranea)
Abb. 1. Pulverschorf (Spongospora subterranea)
Krankheitssymptome
Pulverschorf verursacht violett-braune, in der Regel kreisförmige Pusteln auf der Knollenoberfläche. Die Pusteln sind klein und haben einen Durchmesser von 0.2 bis 5 mm; manchmal dehnen sie sich in die Tiefe und Breite aus. Die Pusteln füllen sich mit einer trockenen, pulverförmigen Masse von Dauersporen (Sporenbälle, die aus vielen Einzelsporen bestehen) (Abb. 1 und 2).
Später platzen die Pusteln auf und geben die pulverförmigen Sporenbälle frei (Abb. 3). Es bleiben kraterförmige Hohlräume zurück, deren Ränder oft von nach oben gewölbten Kartoffelschalen begrenzt werden (Radtke und Rieckmann, 1990).
Auch die Wurzeln und Ausläufer der Kartoffelpflanzen können infiziert werden, wobei sich weisse (an der Luft schwarz werdende) Gallen mit einem Durchmesser von 1 bis 10 mm entwickeln.
Beschreibung des Krankheitserregers
Die Gattung Spongospora gehört zur Familie der Plasmodiophoridae, die kürzlich von den Pilzen in das Reich der Chromista verschoben wurde. Ein weiterer wichtiger Krankheitserreger dieser Familie ist Plasmodiophora brassicae, der Erreger der Kohlhernie bei Raps.
S. subterranea ist ein obligat biotropher Parasit, der in den Wirtszellen Sporenbälle (auch Cystosori oder Sporosori genannt) bildet (Abb. 3). Die Sporenbälle sind meist schwammig, oft hohl, oder mit zahlreichen unregelmäßigen Kanälen und Öffnungen versehen. Sie sind 19-85 µm gross, oval oder unregelmässig geformt (Stevenson et al. 2001). Ein Sporenball besteht aus 500-1000 dickwandigen Einzelsporen mit einem Durchmesser von 3.5-4.5 µm. Unter dem Mikroskop sehen die Sporenbälle weiss und pulvrig aus.
Die primären und sekundären Zoosporen sind 2.5-4.6 µm gross und besitzen zwei peitschenartige Geisseln von ungleicher Länge (4.4-13.7 µm).
Lebenszyklus
Pulverschorf überlebt im Boden in Form von Dauersporen (zusammengesetzt aus vielen Einzelsporen), die bis zu 6 Jahre lebensfähig bleiben (Stevenson et al. 2001). Sie können sogar einen Durchgang durch den Verdauungstrakt von Tieren überleben.
Jede der 500 bis 1000 Einzelsporen einer Dauerspore keimt und setzt eine einzelne primäre Zoospore frei. Diese infizieren die äusseren Pflanzenzellen (Epidermiszellen) von Wurzelhaaren, Wurzeln, Ausläufern (Stolonen) oder Knollen. In der Wirtszelle bildet sich ein vielkerniges Plasmodium, das sich später zu zahlreichen Zoosporangien weiterentwickelt. Diese wiederum entlassen sekundäre Zoosporen, die die Wirtszellen verlassen und einen weiteren Infektionszyklus einleiten. Unter günstigen Umweltbedingungen können mehrere Generationen von sekundären Zoosporen gebildet werden.
Unter bestimmten noch nicht geklärten Bedingungen können sowohl primäre als auch sekundäre Zoosporen mit einer anderen abweichenden Zoospore verschmelzen und eine (diploide) Zygote bilden. Diese Zygote infiziert dann die Knolle oder die Wurzel und bildet ein einzelliges Plasmodium. Das Plasmodium vermehrt sich, durchläuft schliesslich eine Meiose und bildet einen Sporenball, der die ruhenden Einzelsporen enthält.
Pulverschorf entwickelt sich am besten unter kühlen und feuchten Bedingungen. Insbesondere benötigen die Zoosporen freies Wasser, um eine Wirtspflanze zu finden.
Wirtsspektrum
Spongospora subterranea ist weltweit verbreitet und befällt ausser Kartoffeln (Solanum tuberosum) auch andere Knollen bildende Solanum Arten, sowie Paprika (Capsicum annuum), Stechapfel (Datura stramonium), Tomate (Lycopersicon esculentum), Bauerntabak (Nicotiana rustica) und Schwarzen Nachtschatten (Solanum nigrum).
Vorbeugende Bekämpfungsmassnahmen
- Eine gut durchdachte Fruchtfolge und eine Anbaupause von mindestens 6 Jahren einhalten.
- Gut drainierte Böden ohne Staunässe und eine angepasste Bewässerung können die Kartoffeln vor Pulverschorf schützen
- Die Kartoffelfelder müssen unbedingt befallsfrei gehalten werden: Das heisst nur gesundes zertifiziertes Pflanzgut verwenden, keine mit Dauersporen verseuchte Erde in befallsfreie Böden verschleppen, Geräte und Maschinen desinfizieren.
- Keine Hofdünger auf das Feld ausbringen, wenn die Tiere mit pulverschorfigen Knollen gefüttert wurden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Dauersporen des Pulverschorfs den Verdauungstrakt der Tiere überleben.
- Wenig anfällige oder resistente Sorten pflanzen. Insbesonders dann, wenn der Boden mit Dauersporen des Pulverschorfs kontaminiert ist (Schweizer Sortenliste für Kartoffeln).
- Stechapfel und schwarzer Nachtschatten sind ebenfalls Wirtspflanzen des Pulverschorfs. Diese Unkräuter sollten aus den Kartoffelfeldern entfernt werden.
Literatur
Merz U, Schwaerzel R, Keiser A, 2009. Der Pulverschorf der Kartoffel. Kartoffelbau 8: 324-328.
Radtke W, Rieckmann W, 1990. Krankheiten und Schädlinge der Kartoffel. Verlag Th. Mann, Gelsenkirchen-Buer, 167 S.
Stevenson WR, Loria R, Franc GD, Weingartner DP, 2001. Compendium of Potato Diseases, second edition. The American Phytopathological Society, St. Paul: 106 S.