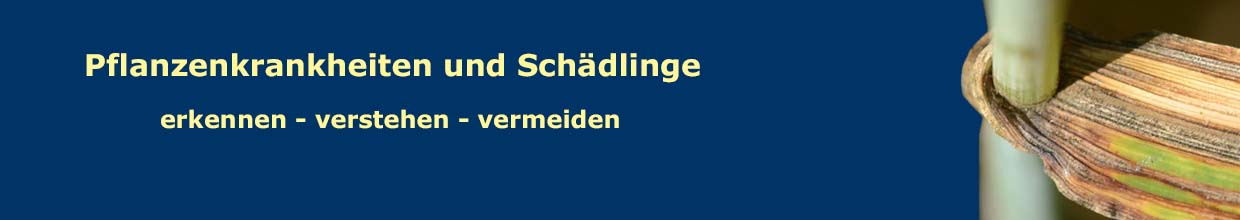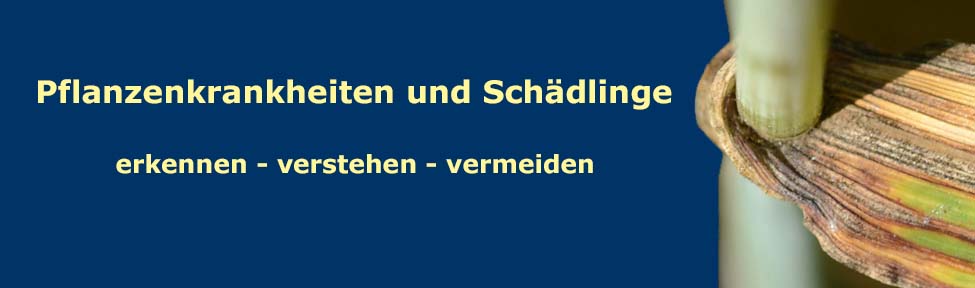Rapserdfloh
altise du colza (franz.); cabbage stem flea beetle (engl.)
wissenschaftlicher Name: Psylliodes chrysocephala L.
Taxonomie: Animalia, Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Polyphaga, Chrysomelidae
Rapserdflöhe (Psylliodes chrysocephala) verursachen typische Frassschäden an den jungen Blättern der Rapspflanzen. Der Hauptschaden wird jedoch durch die Larven verursacht, die in den Blattstielen fressen. Sie können bis zum Vegetationspunkt vordringen und diesen zerstören. In der EU und in der Schweiz ist die Saatgutbehandlung von Raps mit Neonicotinoiden verboten. Damit entfällt eine wichtige Pflanzenschutzmassnahme gegen den Rapserdfloh.

 Abb. 1. Rapserdfloh (Psylliodes chrysocephala): oben adulter Käfer, unten Larve
Abb. 1. Rapserdfloh (Psylliodes chrysocephala): oben adulter Käfer, unten Larve
Schadbild
Ab September fressen die Käfer (Abb. 1) kleine runde Löcher oder Schabstellen in die Keimblätter und Blätter der jungen Pflanzen (Abb. 2). Oft bleibt die obere oder untere Epidermis erhalten (Fensterfrass).
Im Herbst und Winter fressen die Larven in den Blattstielen (Minierfrass) und dringen bis in den Haupttrieb vor (Abb. 3). Die Blattstiele zeigen Ein- und Ausbohrlöcher. Stark durch Minierfrass ausgehöhlte Triebe können durch Frosteinwirkung aufplatzen und auswintern. Das Wachstum ist im Frühjahr stark gehemmt.
Verwechslungsmöglichkeiten: Neben dem Rapserdfloh kommen weitere Arten von Erdflöhen an Raps vor: zum Beispiel der Kohlerdfloh (Phyllotreta spp.). Die Käfer fressen ebenfalls Löcher in die Blätter, die Larven entwickeln sich aber meist an Kohlgewächsen und sind für den Raps selten schädlich (Häni et al. 2008).
Schädling
Die Käfer sind 3 bis 4.5 mm gross und metallisch blauschwarz glänzend (Paul 1992) (Abb. 1). Typisch für den Käfer ist seine Sprungfähigkeit dank der dicken Oberschenkel des hinteren Beinpaares.
Die schmutzig weisse Larve wird bis zu 7 mm lang, hat einen dunkelbraunen Kopf und drei Beinpaare (Abb. 1 und 3). Auf der Hinterleibsplatte der Larve befinden sich zwei kleine Dornen.
Lebenszyklus
Im Mai oder Juni verpuppen sich die ausgewachsenen Larven im Boden. Die Jungkäfer schlüpfen Ende Juni bis Juli in den reifenden Rapsfeldern und fressen an Stängeln und Schoten. Später suchen sie feuchte und kühle Plätze wie Waldränder oder Hecken auf, um den Sommer zu überdauern. Im September fliegen die Käfer in die Neuansaaten von Winterraps und fressen an den Keimblättern und den jungen Blättern (Reifungsfrass). Etwa 10 bis 15 Tage später legen die Weibchen ihre Eier 1 bis 2 cm tief in den Boden neben die Rapspflanzen. Die Eiablage kann sich bis ins Frühjahr hinziehen. Die ersten Larven schlüpfen bereits im September und bohren sich in die Blattstiele der äusseren Rapsblätter ein. Dort verursachen sie braune Frassgänge (Minierfrass). Grössere Larven wandern von den Blattstielen in den Stängel. Befinden sich die Pflanzen zu diesem Zeitpunkt noch im Rosettenstadium (Herbst bis Frühjahr), können die Larven sehr leicht den Vegetationspunkt erreichen. Dies führt zu Wachstumsstörungen im Frühjahr bis hin zu einem Totalausfall. Sobald die Rapspflanzen in die Schossphase wechseln, kann die Larve den Vegetationspunkt nicht mehr erreichen. Der Rapserdfloh entwickelt nur eine Generation pro Jahr.
Epidemiologie
Mildes Herbst- und Winterwetter begünstigt den Befall.
Wirtsspektrum
Winterraps, Rübsen, Kohlarten und überwinternde kreuzblütige Unkräuter (Ackersenf, Hirtentäschelkraut, Hederich)
Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung
- Eine weite Fruchtfolge einhalten
- Neue Rapsparzelle möglichst weit entfernt von der letztjährigen Rapsfläche planen
- Bekämpfung von kreuzblütigen Unkräutern
- Natürliche Feinde fördern (zum Beispiel Schlupfwespen)
- Mulchsaat hemmt die Besiedlung und Eiablage (Kühne et al. 2006)
- Frohwüchsige Rapssorten wählen
- Eine sorgfältige Saatbeetbereitung, eine rechtzeitige (nicht zu dichte) Saat und eine ausgeglichene Düngung fördern ein schnelles Auflaufen sowie die Jugendentwicklung der Rapspflanzen. Dadurch werden Schäden durch Käferfrass vermindert.
- In der EU und in der Schweiz darf Rapssaatgut nicht mehr mit Neonicotinoiden gebeizt werden. Davon betroffen sind die Wirkstoffe Imidacloprid (Gaucho), Clothianidin (Poncho) und Thiametoxam (Cruiser).
- In der Schweiz ist die Bekämpfungsschwelle für Massnahmen gegen den Rapserdfloh wie folgt geregelt (siehe Agridea): Sie ist erreicht, wenn (1) im Keimblattstadium mindestens 50 % der Pflanzen mehrere Frassstellen aufweisen (nur in schwach entwickelten Beständen) oder (2) Mitte bis Ende Oktober (während der Entwicklungsstadien 15-18: "5. bis 8. Laubblatt entfaltet") mindestens 80% der Pflanzen mehrere Frassstellen aufweisen und mehr als 100 Rapserdflöhe pro Gelbschale innerhalb von drei Wochen gefangen werden oder mindestens eine Larve an 7 von 10 Trieben gefunden wird. Es müssen 10 x 5 Pflanzen untersucht werden und Gelbschalen aufgestellt werden. Behandlung nur mit Sonderbewilligung erlaubt!
- Neben den Käfern können auch die Larven des Rapserdflohs mit Insektiziden bekämpft werden. Die Larven verlassen während ihrer Entwicklung mehrmals die Blattstiele und nehmen dabei den Wirkstoff auf. Die Larven des dritten Entwicklungsstadiums sind allerdings nicht mehr bekämpfbar. Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen den Rapserdfloh finden Sie für die Schweiz im BLW Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit).
Literatur
Agridea, 2021. Datenblätter Ackerbau. AGRIDEA, CH-8315 Lindau (Bekämpfungsschwellen)
Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A und Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.
Kühne S, Burth U, Marx P, 2006. Biologischer Pflanzenschutz im Freiland. Eugen Ulmer KG, Stuttgart: 288 S.
Paul V, 1992. Krankheiten und Schädlinge des Rapses. Verlag Th. Mann 2. Auflage: 132 S.